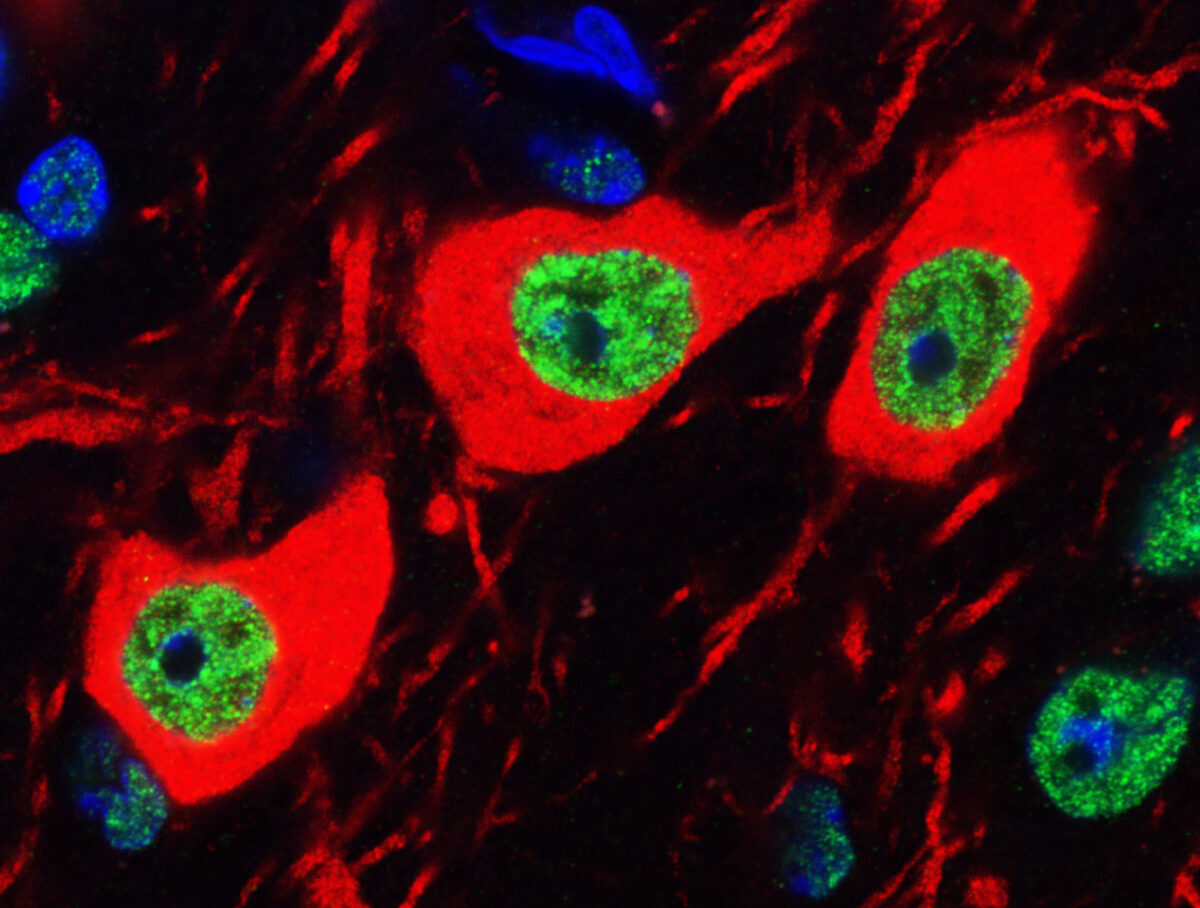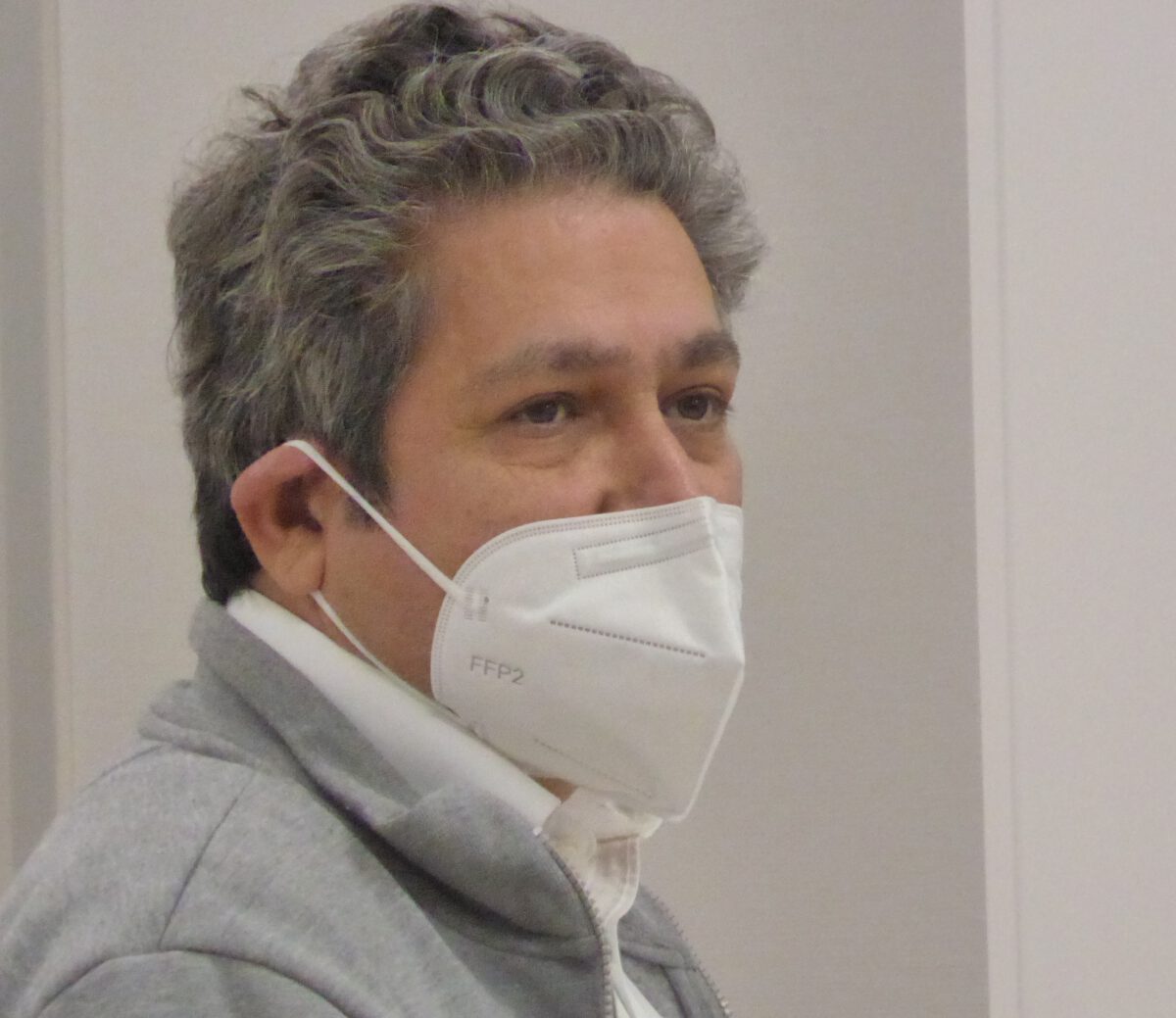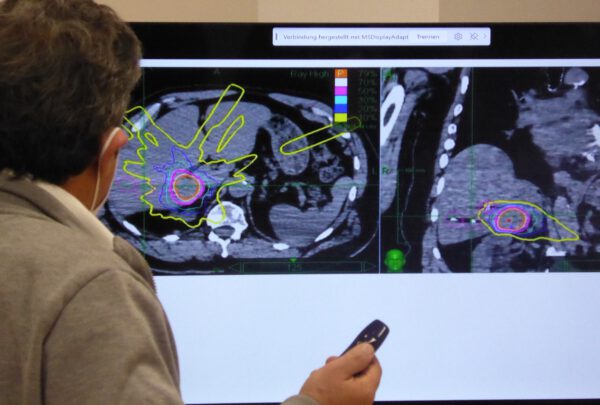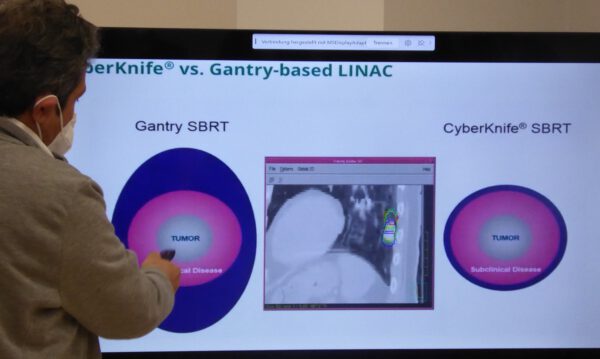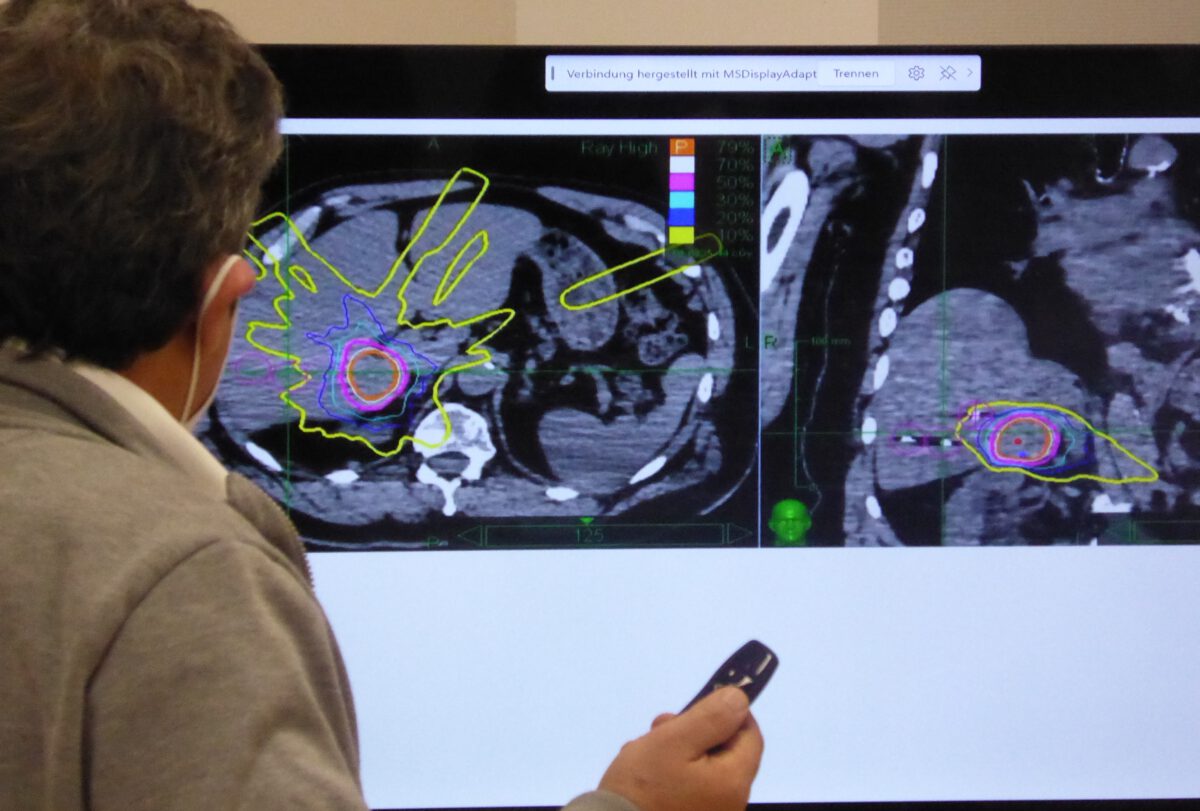Folge 1 Naturheilkunde der Gegenwart
Man stelle sich eine kleine Kiste mit Kühlelementen vor, in die man eine Hand hineinstreckt und auf Besserung von diversen Leiden hofft.
Gurumedizin, oder gar Naturheilbehandlung? Wer solchen Anzeigen von Firmen oder Heilpraktikern ausgesetzt ist, liest oft über angebliche Heilerfolge, die irgendwo, möglicherweise in der hinteren Bergwelt, beobachtet wurden. Also, jemand war krank und die bloße wiederholte Unterkühlung einer Hand weckt Heilkräfte des Körpers. Mit etwas Nachdenklichkeit sollte man wohl schnell erfassen, dass das so gepriesene Konzepte zunächst den eigenen Geldbeutel schmälern und noch keine nachprüfbare Kausalität zwischen Leiden und Heilungserwartung belegen.
Zwar gibt es, vor allem im orthopädischen Bereich Kälteanwendungen und wissenschaftliche Untersuchungen aus dem japanischen Raum, diese sind aber nur im Rahmen gezielter Anwendungen und nach strenger diagnostischer Abklärung in Anwendung. Also nicht unspezifisch und nicht ohne strenge Indikation.
Kann eine solche Vorgehensweise gar schaden oder gefährlich sein?
Als Heilpraktiker mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung musste ich alle Patienten, die mir diese Frage stellten, mit einem klaren Ja konfrontieren. Warum? Unser Körper ist ein Regelwerk, das Reize messbar beantwortet. Dies gilt aber nur, wenn der Körper „gesund“ ist und keine Blockaden aufweist. Wissen, das nicht nur Heilpraktiker, sondern auch jeder Allgemeinmediziner bestätigen kann. Wir wissen auch selbst aus der individuellen Erfahrung, dass wir zeitweise auf Reize wie Kälte oder Wärme unterschiedlich reagieren. Kälte kann Zahnschmerzen verursachen und Wärme unter Umständen auch. Haben wir Entzündungsherde im Körper, melden die sich oft bei Temperaturdifferenzen. Bei besonders problematischen Erkrankungen besteht häufig eine sogenannte „Reaktionsstarre“, das heißt, der Körper reagiert hier nicht so, wie er es im gesunden Zustand täte. Genau hier kommen wir wieder auf unsere Eingangsschilderung zurück. Wird beim Vorliegen eines starren Befundes willkürlich ein unspezifischer Kältereiz durch Unterkühlung einer Hand forciert, kann es zu gesundheitlichen Schäden kommen, denn wir wissen nicht, wie die inneren Organe des Körpers auf diese „Provokation“ reagieren. Im günstigsten Fall ohne Schaden, aber wenig zielführend auf Heilung, oder weniger gewünscht eine Belastung, die einer Gesundung entgegenstehen kann. Besonders empfindlich reagieren unsere Nieren auf derartige Belastungen. Aus all dem folgt, dass nur nach eingehender Messung der Reaktionsfähigkeit und Ausschluss von Herden mit unspezifischen Reizen, wozu auch solche Kältekisten gehören, experimentiert werden könnte. Als Heilpraktiker lehne ich solche Prozeduren, die zumeist von Firmen propagiert werden, die sogar in die Praxen von Heilpraktikern kommen und so deren Umsatz ankurbeln wollen, ab. Dies gilt nicht nur für Kältekammern, sondern auch sonstige unspezifische Reizsetzungen.
Es bleibt also die Frage, kann man die Regulation eines Körpers messen und gültige Annahmen über das Reaktionsschema des Körpers gewinnen? Ja, das ist möglich und wird sowohl von Ärzten und auch von Heilpraktikern durchgeführt. Natürlich wird nicht jeder Hausarzt eine Bioelektrische Funktionsdiagnostik durchführen, oder Verfahren der Elektroakkupunktur beherrschen. Dies ist zumeist spezialisierten Ärzten im Bereich der Naturheilverfahren oder Heilpraktikern mit dieser Spezialisierung vorbehalten.
Wir werden in den kommenden Folgen mehr über die Regulationsmedizin und der Naturheilkunde berichten.
Allgemeine Rückfragen können über unsere Dornumer oder Essener Praxis beantwortet werden.
Individuelle Behandlungsanfragen nur nach telfonischer Terminabsprache. Individuelle medizinische Beratung ist nur nach Untersuchung und Befundung, die nicht telefonisch erfolgen kann, möglich. Wir führen auch Hausbesuche durch.
Telfon: 0163 666 444 3 (für beide Praxen, Dornum, Essen)
Hans-Joachim Steinsiek, Dipl-Sozialarbeiter, Heilpraktiker, Journalist
Dieser Artikel erscheint im Rahmen einer Artikelserie, die auch unter der Facebookgruppe „Dornumer Nachrichten“ veröffentlicht wird und ist Teil einer redaktionellen Verlagsveröffentlichung. Wiedergabe und Abdruck daher nur mit Genehmigung des Verfassers.